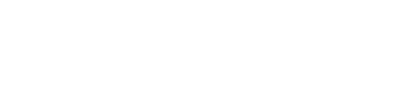In den vergangenen Jahren haben Behandlungsformen zur gezielten Modulation von Immunzellen, sogenannte Immuntherapien, die Prognose vieler Tumorerkrankungen erheblich verbessert. Bei aggressiven, bösartigen Hirntumoren wie dem Glioblastom blieb dieser Durchbruch jedoch aufgrund noch nicht vollständig verstandener Mechanismen aus. Unser Forschungsteam hat nun erstmals Ansammlungen hochwirksamer Immunzellen im Schädelknochen von Patienten entdeckt, die langfristig einen gezielten Ansatzpunkt für die Behandlung bösartiger hirneigener Tumoren bieten könnten.
Die Entdeckung beruht auf aktiven nationalen und internationalen Kooperationen und vor allem auf der engen Zusammenarbeit der WissenschaftlerInnen unseres Teams (Translationalen Neuroonkologie) mit den Essener Universitätskliniken für Neurochirurgie und Nuklearmedizin und mit dem Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin (Foto, v.l.n.r. Prof. Dr. Florian Rambow, Prof. Dr. Björn Scheffler, Prof. Dr. Ulrich Sure, Dr. Celia Dobersalske, Prof. Dr. Ken Hermann, PD Dr. Laurèl Rauschenbach). Das knöcherne Reservoir befindet sich genau neben dem Tumor und beherbergt unter anderem zytotoxische T-Lymphozyten (CD8+-Zellen), hocheffektive Zellen des adaptiven (erworbenen) Immunsystems, die bei der Krebsabwehr eine essenzielle Rolle spielen. Durch den Einsatz neuester einzelzellbasierter Analysen, bei denen der spezifische T-Zell-Rezeptor auf der Oberfläche der Zellen ausgelesen wird, konnte nachgewiesen werden, dass diese Zellen auch in das Tumorgewebe einwandern und damit als lokale, potente Krebsabwehr dienen.
Die Entdeckung dieses lokal aktivierten Immunsystems könnte die Chance bieten, innovative Therapien neu zu denken, zum Beispiel durch Einbindung dieser besonderen Zellen in zukünftige Behandlungskonzepte. Neue Studien unserer Arbeitsgruppe werden diese Idee strategisch weiterentwickeln. Zusätzliche Informationen zum Thema erhalten Sie hier.
Dobersalske, C. et al. Cranioencephalic functional lymphoid units in glioblastoma. Nat Med 30, 2947–2956 (2024). https://www.nature.com/articles/s41591-024-03152-x